
Am Universitätsklinikum Essen, einem ausgewiesenen Sarkomzentrum, beschäftigt sich unter anderem die Kinderklinik III, Leitung Prof. Dr. med Dirksen, mit der Diagnostik von Knochensarkomen. Die Erfahrung aus der Versorgung zeigt: Viele Betroffene haben bereits einen langen Weg hinter sich, bevor die richtige Diagnose gestellt wird. Das liegt vor allem daran, dass erste Anzeichen sehr unspezifisch sind und oft fehlgedeutet werden.
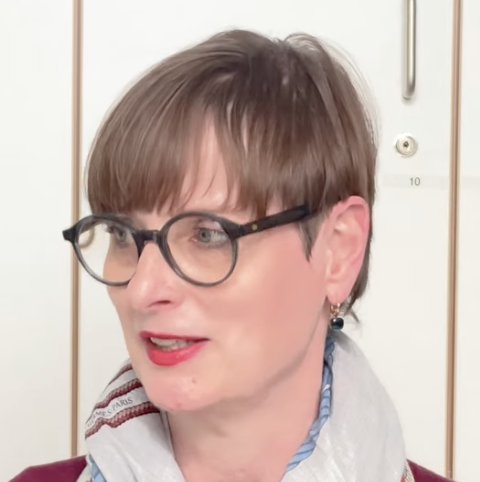
Karin Strube
Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Strube Stiftung

Univ.-Prof. Dr. med Uta Dirksen
Kommissarische Direktorin für Kinderheilkunde III am Universiätsklinikum Essen
Wer ist betroffen?
Frühe Anzeichen
Erste Bildgebung
Weiterführende Diagnostik
CT und Staging
Sarkomzentrum – wann hin?
Biopsie
Ziel der gesamten Diagnostik
Knochensarkome können grundsätzlich in jedem Alter auftreten. Die beiden häufigsten bösartigen Formen, das Osteosarkom und das Ewing-Sarkom, zeigen jedoch einen Häufigkeitsgipfel im Jugendalter – etwa um das 15. Lebensjahr. In dieser Lebensphase wird an Krebs oft gar nicht gedacht, was die Diagnose oft verzögert.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Podigee. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDas häufigste Symptom sind Schmerzen im Bereich des betroffenen Knochens. Häufig werden sie erstmals nach körperlicher Belastung bemerkt – etwa nach einem Sprint, einem Sprung oder beim Tanzen. Die Beschwerden können zwischenzeitlich wieder nachlassen. Viele deuten sie deshalb zunächst als Zerrung oder Überlastung.
Ein Warnsignal ist, wenn die Schmerzen nach einigen Wochen weiterhin bestehen oder neu auch in Ruhe bzw. nachts auftreten. Spätestens dann sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.
Die Schmerzen rühren häufig von der Knochenhaut (medizinisch: Periost) her. Sie ist reich an Nervenfasern und sehr schmerzempfindlich – das merkt man auch, wenn man sich am Schienbein stößt oder einen Knochenbruch erleidet. Wird die Knochenhaut gereizt, können bereits geringe zusätzliche Belastungen deutliche Schmerzen auslösen.
„Häufig ist häufig“ – diesem Prinzip folgend werden die Beschwerden anfangs oft als Zerrung, Prellung oder Muskelverspannung eingeschätzt. Ratschläge wie Schonung, Kühlung oder eine schmerzlindernde Salbe sind in dieser Phase üblich. Das trägt jedoch dazu bei, dass wertvolle Zeit vergeht, bis an eine Tumorursache gedacht wird.
Anhaltende oder nächtliche Knochenschmerzen sollten ernst genommen und ärztlich abgeklärt werden. Das gilt insbesondere, wenn die Beschwerden trotz Schonung nicht verschwinden oder immer wiederkehren. Ein frühzeitiger Arztbesuch kann den Weg zur richtigen Diagnose deutlich verkürzen.
In der Kinder- und Jugendmedizin wird bei wiederkehrenden Beinschmerzen häufig der Begriff „Wachstumsschmerz“ verwendet. Diese Bezeichnung ist eine Ausschlussdiagnose: Sie kommt erst in Betracht, wenn ernsthafte Ursachen unwahrscheinlich sind. Bei nachhaltigen Schmerzen ist eine weiterführende Abklärung erforderlich.
Knochensarkome lassen sich häufig bereits mit einer einfachen, kostengünstigen Untersuchung erkennen: dem konventionellen Röntgenbild. Viele Patienten erhalten diese erste Bildgebung in der Haus- oder Facharztpraxis.
Auf einem normalen Röntgenbild zeigen sich bei bösartigen Knochentumoren charakteristische Muster:
Ähnliche Veränderungen können in seltenen Fällen auch durch eine Knochenentzündung entstehen. Auch das sollte erkannt und entsprechend behandelt werden.
Spezifische Blutwerte, die ein Knochensarkom beweisen, gibt es nicht. Bei größeren Tumoren können Entzündungszeichen leicht erhöht sein. Das ist unspezifisch und kann auch in eine falsche Richtung deuten.
Bei Verdacht auf ein Knochensarkom wird in der Regel eine MRT durchgeführt. Gründe:
Die MRT arbeitet ohne Strahlenbelastung und basiert auf starken Magnetfeldern. Die Untersuchung findet in einer engen Röhre statt und ist laut; ein Gehörschutz ist wichtig.
Bei Knochensarkomen gehört ein CT zur Basisabklärung. Ziel ist vor allem, Tochtergeschwulste (Metastasen) aufzuspüren, die bei diesen Tumoren häufig in der Lunge auftreten. Die Lunge lässt sich im CT deutlich besser beurteilen als mit anderen Verfahren. Je nach Lage – etwa bei Tumoren, die von der Rippe ausgehen – kann das CT auch für die Darstellung des Primärtumors Vorteile haben. In einzelnen Situationen werden MRT und CT ergänzend eingesetzt.
Die Strahlenbelastung eines CT ist höher als bei einem normalen Röntgenbild. Moderne Geräte arbeiten jedoch mit geringeren Dosen als ältere. Meist wird das erste CT sehr dünnschichtig und detailliert durchgeführt, was eine höhere Dosis bedeuten kann. Nachfolgende Kontrollen sind oft als Low-Dose-CT möglich. Entscheidend ist: Die exakte Diagnose und Behandlungsplanung haben Vorrang – ohne präzise Bildgebung können Herde übersehen werden.
Das CT-Gerät ist kein enger Tunnel, sondern eher ein großer Ring. Die Untersuchung ist kurz, macht vergleichsweise wenig Geräusche und wird von vielen als gut tolerierbar empfunden.
Zur Erstabklärung (Staging) wird zusätzlich eine Ganzkörperuntersuchung durchgeführt – bevorzugt PET-MRT oder PET-CT. Dabei wird ein leicht radioaktiv markierter Stoff gespritzt, der sich in Bereichen mit erhöhter Aktivität anreichert. Auf den Bildern erscheinen solche Areale auffällig „leuchtend“; der übrige Körper ist nur mild gefärbt.
Organe mit dauerhafter Aktivität wie Herz und Gehirn leuchten immer. Die PET-basierte Ganzkörperbildgebung liefert einen zuverlässigen Überblick bis in entlegene Körperregionen und hilft, Streuherde zu erkennen. Sie ist jedoch nicht vollständig spezifisch: Entzündungen oder frische Verletzungen können ebenfalls „leuchten“. Deshalb werden die Befunde immer im Zusammenhang mit der Krankengeschichte und den übrigen Untersuchungen interpretiert.
In ein Sarkomzentrum sollte man gehen, sobald der Verdacht auf ein Sarkom besteht. Das kann bereits nach einer auffälligen Röntgenaufnahme der Fall sein. Niedergelassene Ärzte können Betroffene dann direkt an ein Zentrum überweisen; dort wird die weitere Diagnostik koordiniert.
Die weiterführende Bildgebung (z. B. CT der Lunge oder PET-CT/PET-MRT für das Ganzkörper-Staging) wird meist im Zentrum durchgeführt, weil diese Verfahren dort regelhaft verfügbar sind.
Ein MRT kann – je nach Verfügbarkeit – auch außerhalb des Zentrums entstehen; die Planung und Auswertung erfolgen jedoch in der Regel durch das Zentrum.
Bei dringendem Verdacht auf ein Sarkom bemühen sich die Zentren um zeitnahe Termine. Das Personal in den Zentren weiß, wie wichtig eine schnelle Anbindung für Diagnostik und Therapie ist; lange Wartezeiten sind in dieser Situation nicht die Regel.
Eine Biopsie ist die Entnahme einer Gewebeprobe aus der verdächtigen Region. Nur anhand dieses Gewebes kann sicher festgestellt werden, welche Tumorart vorliegt – eine unverzichtbare Grundlage für die weitere Behandlung.
Es gibt zwei gängige Verfahren:
Welche Methode gewählt wird, hängt von Lage und Art des Tumors ab.
Für eine verlässliche Diagnose braucht es genug Material. Zu kleine Proben bedeuten oft, dass nachentnommen werden müsste – eine zusätzliche Belastung. Mehrere Nadelstanzen erhöhen die Chance, dass alle notwendigen Untersuchungen möglich sind.
Die Proben gehen schnell in die Pathologie. Dort erfolgen:
Für Molekulartests wird teils frisches und nicht eingebettetes Material benötigt – ein weiterer Grund, ausreichend zu entnehmen.
Knochensarkome sind selten. Es gibt zwar viele sehr gute Pathologien, aber nur wenige sehen diese Tumorarten regelmäßig. In Sarkomzentren wird die Biopsie so geplant, dass genügend Material vorliegt, und die Proben werden bei Bedarf gezielt an Spezialisten geschickt – inklusive Zweitmeinung je nach vermuteter Sarkomart.
Erst wenn klar ist, wie der Tumor genau heißt, kann die Therapie richtig geplant werden. Knochensarkome unterscheiden sich deutlich voneinander und werden unterschiedlich behandelt. Nach der Diagnosesicherung folgt häufig der nächste Schritt der Behandlung, meist eine Chemotherapie.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen