
Die Diagnose „Knochensarkom“ ist für viele Betroffene und ihre Angehörigen zunächst sehr erschreckend. Besonders schwer ist es, wenn Kinder, auch sehr kleine Kinder oder Jugendliche, betroffen sind – was bei dieser Erkrankung leider häufig der Fall ist. Umso wichtiger ist es, die Krankheit besser zu verstehen und sich gut zu informieren. Frau Prof. Dr. med Uta Dirksen vom Universitätsklinikum Essen gibt einen guten Überblick zum Thema Knochensarkome.
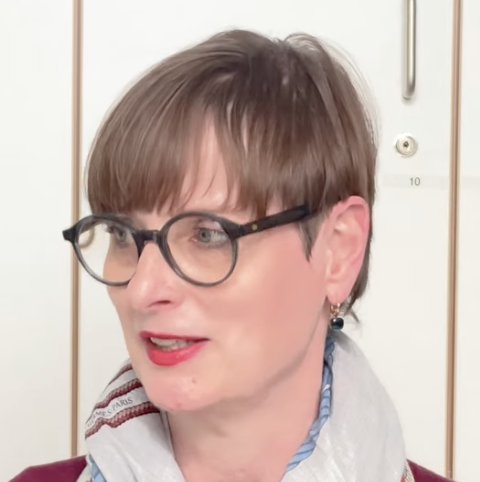
Karin Strube
Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Strube Stiftung

Univ.-Prof. Dr. med Uta Dirksen
Kommissarische Direktorin für Kinderheilkunde III am Universiätsklinikum Essen
Grundlagen Knochensarkome
Typische Lokalisationen im Körper
Altersverteilung
Symptome & Früherkennung
Diagnostik
Therapiebeginn
Bestrahlung
Moderne Therapien (Immuntherapie etc.)
Zweitmeinung & Register
Im Alltag hört man oft den Begriff „Knochenkrebs“. Meist ist damit ein sogenanntes Knochensarkom gemeint. Das sind bösartige Tumoren, die direkt im Knochen entstehen. Man kann also sagen: Wenn Krebs aus dem Knochengewebe selbst entsteht, handelt es sich in der Regel um ein Knochensarkom.
Davon abzugrenzen sind sogenannte Knochenmetastasen. Diese entstehen, wenn ein anderer Tumor – zum Beispiel Brust- oder Prostatakrebs – in andere Körperregionen gestreut hat und sich dabei auch im Knochen ansiedelt. Solche Metastasen im Knochen sind häufiger als Knochensarkome.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Podigee. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDer hier vorgestellte Überblick richtet sich gezielt an Menschen, bei denen ein Knochensarkom festgestellt wurde. Für Betroffene mit Knochenmetastasen – also einer Absiedelung eines anderen Tumors im Knochen – gelten meist ganz andere Behandlungskonzepte. Für diese Patienten ist der Inhalt nur in bestimmten Teilaspekten (z.B. lokale Behandlung) von Bedeutung.
Es gibt drei Hauptformen bösartiger Knochentumoren. Diese unterscheiden sich danach, aus welchem Gewebe sie entstehen:
1. Osteosarkom – der häufigste bösartige Knochentumor Es entsteht aus veränderten Knochenzellen. Diese Zellen haben ihre normale Funktion verloren, wachsen unkontrolliert weiter und können sich im Körper ausbreiten. Bei Kindern wird manchmal anschaulich gesagt: „Die Knochenzellen sind verrückt geworden.“
2. Chondrosarkom – Tumor aus Knorpelgewebe Das Chondrosarkom ist der zweithäufigste bösartige Knochentumor. Es geht aus Knorpelzellen hervor – also aus Gewebe, das sich nicht nur an den Gelenken befindet, sondern auch innerhalb von Knochen. Chondrosarkome wachsen oft langsamer als andere Sarkome.
3. Ewing-Sarkom – eine sehr seltene Form Es entsteht aus Zellen, die sich im Knochen befinden, aber keine eigentlichen Knochenzellen sind. Man geht davon aus, dass es sich um sogenannte mesenchymale Stammzellen handelt – das sind unreife Zellen, die sich normalerweise erst zu verschiedenen Geweben entwickeln würden.
Neben den bösartigen Tumoren gibt es auch viele gutartige Veränderungen im Knochen. Dazu zählen zum Beispiel kleine Knötchen oder gutartige Wucherungen. Diese sind insgesamt deutlich häufiger als Knochensarkome und verursachen oft keine Beschwerden. Sie müssen meist nicht behandelt werden.
Die drei Hauptformen bösartiger Knochensarkome zeigen unterschiedliche bevorzugte Lokalisationen im Körper:
Erfahrene Ärzte können anhand von Bildaufnahmen – wie Röntgenbildern, MRT oder CT – häufig bereits eine begründete Vermutung äußern, um welche Art von Sarkom es sich handeln könnte. Dennoch ist eine Gewebeprobe (Biopsie) immer notwendig, um die genaue Diagnose zu sichern. Auch bei typischem Aussehen gibt es immer wieder Überraschungen.
Knochensarkome sind nicht gleichmäßig über alle Altersgruppen verteilt. Die verschiedenen Typen zeigen ein unterschiedliches Erkrankungsalter:
Trotz typischer Altersverteilung kann ein Knochensarkom auch in sehr jungen oder sehr alten Lebensphasen auftreten. Es wurden bereits Ewing-Sarkome bei Säuglingen und auch bei über 80-jährigen Patientinnen und Patienten festgestellt. Das zeigt: In der Medizin gilt stets, aufmerksam zu bleiben – gerade bei seltenen Erkrankungen. Unklare Beschwerden sollten deshalb in spezialisierten Zentren abgeklärt werden, die Erfahrung mit solchen seltenen Tumoren haben.
Auch wenn es zwei Altersgipfel gibt – zum Beispiel beim Osteosarkom –, handelt es sich in der Regel um dieselbe Erkrankung. Die Behandlung wird allerdings je nach Alter angepasst. Ältere Menschen vertragen manche Medikamente schlechter, weshalb Therapien individuell angepasst werden müssen.
Auffällig ist, dass jüngere Menschen häufig eine bessere Prognose haben. Warum das so ist, ist noch nicht vollständig geklärt. Es liegt wahrscheinlich nicht allein an der körperlichen Stärke, sondern könnte auch mit biologischen Veränderungen in der Pubertät oder anderen altersabhängigen Faktoren zusammenhängen.
Knochensarkome gehören zu den sehr seltenen Krebserkrankungen. Ein Osteosarkom tritt etwa bei einem von 100.000 Menschen auf – das ist bereits selten. Das Ewing-Sarkom ist sogar noch seltener und betrifft nur etwa ein bis drei von einer Million Menschen.
Diese Zahlen beziehen sich auf die allgemeine Bevölkerung – also auf alle Menschen unabhängig von anderen Erkrankungen oder Risikofaktoren.
Auffällig ist außerdem: Während das Osteosarkom Menschen aller Hautfarben betreffen kann, tritt das Ewing-Sarkom fast ausschließlich bei weißen Menschen auf. Das deutet darauf hin, dass es genetische Faktoren gibt, die das Risiko beeinflussen. Die genauen Zusammenhänge sind allerdings noch nicht vollständig verstanden.
Knochensarkome machen sich anfangs häufig nicht mit typischen „Krebs-Symptomen“ bemerkbar. Das heißt:
Stattdessen berichten viele Betroffene von Schmerzen, die zunächst mit einem bestimmten Ereignis in Verbindung gebracht werden – zum Beispiel Sport, ein Sturz oder eine vermeintliche Zerrung. Das ist nachvollziehbar, und deshalb wird der Schmerz oft zunächst nicht ernst genommen.
Ein wichtiger Warnhinweis ist: Wenn Schmerzen länger als vier Wochen bestehen und es keine klare Erklärung dafür gibt, sollte man unbedingt ein Röntgenbild anfertigen lassen. Oft erleben Ärzte, dass Patienten erst nach vielen Monaten – manchmal vier bis sechs – mit der Diagnose kommen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Tumor manchmal bereits Metastasen gebildet. Das erschwert die Behandlung.
Ein einfaches Röntgenbild reicht in vielen Fällen aus, um ein Knochensarkom zu erkennen. Moderne Geräte arbeiten mit sehr geringer Strahlenbelastung – daher spricht aus medizinischer Sicht nichts dagegen, eine Bildgebung frühzeitig durchzuführen. Diese erste Untersuchung kann entscheidend sein, um die Erkrankung rechtzeitig zu erkennen.
Knochensarkome treten häufig im Jugendalter auf. Doch genau in dieser Lebensphase sprechen Jugendliche oft nicht über Schmerzen – sei es aus Scham, aus Ablösungsprozessen in der Familie oder weil andere Dinge im Vordergrund stehen. Selbst wenn sie sich Hilfe holen, wird der Schmerz zunächst häufig als Sportverletzung eingeordnet – was durchaus nachvollziehbar ist.
Im Verlauf der Erkrankung treten bei vielen Betroffenen auch Schwellungen auf – insbesondere, wenn der Tumor größer wird. Anfangs sind diese oft nur leicht ausgeprägt und fallen nicht weiter auf. Viele erklären sich die Schwellung durch eine vermutete Sportverletzung oder Prellung.
Spätestens wenn eine Schwellung über Wochen bestehen bleibt oder deutlich zunimmt, sollte eine genaue Abklärung erfolgen – selbst wenn es sich am Ende „nur“ um eine Entzündung handelt.
Bei folgenden Warnzeichen sollte ein Besuch beim Hausarzt erfolgen – idealerweise mit anschließender Bildgebung:
Ein einfaches Röntgenbild kann hier oft der erste entscheidende Schritt sein – und möglicherweise Leben retten.
Wenn der Verdacht auf ein Knochensarkom besteht, ist eine Röntgenaufnahme meist der erste Schritt. Sie ist kostengünstig, schnell verfügbar und reicht oft aus, um eine auffällige Veränderung im Knochen zu erkennen.
Ein Ultraschall kann ergänzend eingesetzt werden – vor allem dann, wenn der Tumor nahe an der Körperoberfläche liegt oder bereits eine Schwellung vorhanden ist. Der Ultraschall zeigt dann vor allem Veränderungen im Weichteilgewebe rund um den Knochen. Für die genaue Beurteilung eines Knochentumors reicht er allein jedoch nicht aus.
Besteht nach der ersten Untersuchung ein konkreter Verdacht auf ein Knochensarkom, folgt in der Regel eine Magnetresonanztomografie (MRT). Sie ist besonders gut geeignet, um den Tumor in seiner Ausdehnung im Knochen und im umliegenden Gewebe darzustellen. Bei Tumoren im Brustbereich kommt manchmal auch eine Computertomografie (CT) zum Einsatz – bei Kindern jedoch seltener wegen der höheren Strahlenbelastung.
Wenn der Verdacht auf ein Sarkom besteht, sollte die weitere Diagnostik und Therapie unbedingt in einem Sarkomzentrum erfolgen. Dabei ist es wichtig, gezielt nach Zentren für Knochensarkome zu suchen – nicht nur für Weichteilsarkome. Nicht alle sogenannten „Sarkomzentren“ sind auf Knochentumoren spezialisiert.
Ein zentrales Kriterium: Die Biopsie (Gewebeprobe) sollte von der Person durchgeführt werden, die später auch die Operation übernimmt. Der Grund: Jeder Einstichkanal muss bei der späteren Operation mit entfernt werden. Fehlerhafte oder ungünstig gesetzte Biopsien können den Eingriff unnötig vergrößern und die Heilungschancen verschlechtern.
Eine Übersicht über spezialisierte Zentren bietet zum Beispiel die Deutsche Sarkomstiftung.
Wenn der Verdacht auf ein bösartiges Knochensarkom besteht, läuft die Diagnostik in mehreren Schritten:
1. Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie)
Diese Probe wird in der Pathologie untersucht. Da Knochen erst entkalkt werden muss, dauert die Auswertung länger als bei anderen Tumoren – oft etwa 10 bis 14 Tage.
2. Ganzkörperuntersuchung (Staging)
Noch vor dem endgültigen Befund wird bei hohem Verdacht häufig schon eine umfassende Bildgebung des gesamten Körpers eingeleitet. So kann festgestellt werden, ob der Tumor bereits Metastasen gebildet hat – z.?B. in der Lunge oder in anderen Knochen.
3. Vorbereitung auf die Therapie
Dazu gehören Untersuchungen von Herz, Lunge (Lungenfunktionsprüfung), Blutwerten und anderen Organfunktionen.
4. Gespräch zur Fruchtbarkeitserhaltung
Bei jungen Menschen wird frühzeitig darüber gesprochen, wie die Fruchtbarkeit erhalten werden kann – etwa durch Kryokonservierung von Eizellen, Samen oder Eierstockgewebe, da die Chemotherapie sie beeinträchtigen kann.
Nach der Diagnose eines Knochensarkoms beginnt die Behandlung in der Regel mit einer Chemotherapie. Diese wird meist nicht über die normalen Armvenen gegeben, da die Medikamente sehr reizend sind und die kleinen Gefäße schädigen könnten. Stattdessen wird ein sogenannter Portkatheter eingesetzt – ein zentraler Zugang, der unter der Haut liegt und über einen großen Venenanschluss verfügt. Darüber wird die Chemotherapie sicher verabreicht.
Bei Osteosarkomen und Ewing-Sarkomen beginnt die Behandlung fast immer mit einer Chemotherapie – also vor der Operation. Einzige Ausnahme sind Chondrosarkome, die in der Regel nicht auf Chemotherapie ansprechen und deshalb primär operiert werden. Die Ziele der vorgeschalteten Chemotherapie sind:
Im weiteren Verlauf kann die Therapie – je nach Ansprechen – individuell angepasst werden. Beim Ewing-Sarkom gibt es zum Beispiel etablierte Therapiewechsel bei schlechtem Ansprechen. Beim Osteosarkom ist das bislang (noch) nicht Standard, könnte sich aber durch neue Studien ändern.
Die Operation spielt weiterhin eine zentrale Rolle – vor allem beim Osteosarkom. Ziel ist die möglichst vollständige Entfernung des Tumors. Ist eine Operation aus anatomischen Gründen nicht möglich, kann eine Strahlentherapie notwendig werden.
Viele Betroffene wünschen sich moderne Therapieformen wie Immuntherapie oder zielgerichtete Antikörperbehandlungen, da diese oft als „schonender“ wahrgenommen werden. Für Knochensarkome gilt jedoch:
Dabei darf man nicht vergessen: Viele dieser neuen Verfahren haben zum Teil schwere Nebenwirkungen, etwa schwere Entzündungsreaktionen oder Organschäden.
Auch wenn moderne Begriffe wie „Immuntherapie“ zunächst attraktiver klingen, gilt für Knochensarkome derzeit: Die bestwirksame und erprobte Therapie ist die klassische Kombination aus Chemotherapie, Operation und ggf. Bestrahlung. Neue Therapieansätze werden in Studien erforscht – sind aber (noch) kein Standard in der Erstbehandlung.
Für Patienten mit einem Knochensarkom ist es grundsätzlich sehr wichtig, in einem Sarkomzentrum behandelt zu werden. Diese spezialisierten Einrichtungen haben Erfahrung mit den seltenen Tumoren und sind an entsprechende Studien und Register angebunden.
Wenn man bereits in einem Sarkomzentrum betreut wird, stellt sich die Frage: Braucht man dann überhaupt noch eine Zweitmeinung?
Die Antwort lautet: In vielen Fällen ist sie bereits integriert. Bei Ewing-Sarkomen und Osteosarkomen gibt es bundesweit organisierte Studiengruppen. Diese bieten routinemäßig Zweitmeinungen an – zum Beispiel zur OP-Planung oder bei schwierigen Entscheidungen.
Eine Zweitmeinung muss nicht bedeuten, dass man weite Strecken reisen muss. Viele Zentren – wie etwa das Uniklinikum Essen – bieten die Möglichkeit, dass bildgebende Verfahren (z.B. MRT, CT) und medizinische Unterlagen digital übermittelt werden. Die Beurteilung erfolgt dann im Rahmen eines interdisziplinären Tumorboards mit Experten aus verschiedenen Fachbereichen:
Die Patienten profitieren so von einer fundierten Einschätzung, ohne zwingend persönlich vor Ort sein zu müssen.
Patienten mit Knochensarkomen werden in Deutschland idealerweise in Register und klinische Studien eingeschlossen. Diese dienen nicht nur der persönlichen Betreuung, sondern auch der langfristigen Auswertung und Weiterentwicklung der Therapie:
Die Teilnahme an einem solchen Register oder einer Studie bedeutet also auch: Die eigene Erkrankung trägt zur besseren Versorgung zukünftiger Patienten bei.
So verständlich der Wunsch nach Sicherheit ist: Zu viele Zweit- oder Drittmeinungen können gefährlich sein. Nach der Diagnose zu viele Meinungen einzuholen ist gefährlich, denn:
Daher der klare Rat: Eine fundierte Zweitmeinung ja – aber danach entschlossen handeln und die Therapie beginnen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen